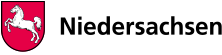Wie läuft das Regelinsolvenzverfahren ab?
Das Regelinsolvenzverfahren beginnt mit einem Antrag, der im sogenannten Eröffnungsverfahren vom Insolvenzgericht geprüft wird. Liegen alle Voraussetzungen vor, wird das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet. Hieran kann sich gegebenenfalls das Restschuldbefreiungsverfahren anschließen.
Welche Arten der Zwangsvollstreckung gibt es?
Je nachdem, welchen Anspruch der einzelne Gläubiger hat, kommen verschiedene Wege der Einzelzwangsvollstreckung in Betracht:
Anspruch auf Zahlung von Geld
Besteht ein Anspruch auf Geldzahlung, so kann die Gläubigerin / der Gläubiger zwischen folgenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wählen:
Im Rahmen der Mobiliarvollstreckung kann die Gerichtsvollzieherin /der Gerichtsvollzieher die Forderung eintreiben, bewegliche Habe der Schuldnerin / des Schuldners pfänden und verwerten oder die Vermögensauskunft abnehmen.
Mit Hilfe der Forderungsvollstreckung kann der Gläubiger in Forderungen vollstrecken, die der Schuldner gegen Dritte hat, zum Beispiel Arbeitseinkommen oder Kontoguthaben.
Der Gläubiger kann Immobilien des Schuldners zwangsversteigern oder unter Zwangsverwaltung stellen lassen.
Anspruch auf Herausgabe einer Sache (Herausgabevollstreckung)
Besteht eine Herausgabepflicht, nimmt der Gerichtsvollzieher [Link intern: Zwangsvollstreckung/ Die Gerichtsvollzieherin/der Gerichtsvollzieher] die Sache aus dem Besitz des Schuldners und übergibt sie dem Gläubiger.
Anspruch auf eine Handlung (Handlungsvollstreckung)
Ist der Schuldner zur Vornahme einer Handlung, zum Beispiel zum Fällen eines Baumes, verpflichtet, kann der Gläubiger ermächtigt werden, die Handlung auf Kosten des Schuldners selbst vorzunehmen. Wenn nur der Schuldner persönlich die Handlung vornehmen kann, kann der Schuldner durch Zwangsgeld oder Zwangshaft zu dieser Handlung angehalten werden.
Anspruch auf Unterlassung (Unterlassungsvollstreckung)
Ist der Schuldner verpflichtet, eine bestimmte Handlung, wie etwa Verleumdung oder Kontaktaufnahme, zu unterlassen, so kann gegen ihn im Fall der Zuwiderhandlung Ordnungsgeld oder Ordnungshaft verhängt werden.
Berufung und Revision
 Bildrechte: www.wyrwa-foto.de
Bildrechte: www.wyrwa-foto.deSie sind in der ersten Instanz zu einer Zahlung verurteilt worden und möchten dieses Urteil anfechten? Ihre Klage ist abgewiesen worden und Sie halten die Begründung für falsch?
Wenn die Parteien sich nicht einigen, endet ein Zivilprozess in der Regel mit einem Urteil. Durch dieses Urteil wird entweder die Klage abgewiesen oder die beklagte Partei zu etwas verurteilt - zum Beispiel zu einer Zahlung. Es kann auch vorkommen, dass beide Parteien teilweise Recht bekommen, also eine Klage nur zum Teil abgewiesen wird.
Urteile des Amtsgerichts oder des Landgerichts können mit dem Rechtsmittel der Berufung angefochten werden. Bei Urteilen des Amtsgerichts muss die Berufung beim Landgericht, bei Urteilen des Landgerichts muss die Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt werden. In jedem Fall muss die Berufung von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt eingelegt werden. Dabei sind Fristen zu beachten: Die Berufung muss innerhalb eines Monats, nachdem das Urteil zugestellt wurde, eingelegt werden und innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung des Urteils begründet werden.
Nicht in jedem Fall kann das Urteil der ersten Instanz im Wege der Berufung überprüft werden. Dies ist nur möglich, wenn eine Partei mit einem Wert von mehr als 600,00 EUR verloren hat oder das Gericht der ersten Instanz die Berufung im Urteil ausdrücklich zulässt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine wichtige Rechtsfrage durch ein Gericht höherer Instanz geklärt werden sollte.
Das Berufungsgericht überprüft ein angefochtenes Urteil nicht vollständig neu. Die Richterinnen und Richter sind grundsätzlich an die Tatsachenfeststellungen des Gerichts erster Instanz gebunden. Eine neue Beweisaufnahme wird nur durchgeführt, wenn das Berufungsgericht konkrete Anhaltspunkte für Zweifel daran hat, dass die erstinstanzlichen Feststellungen richtig bzw. vollständig sind. Darüber hinaus können Tatsachen in der Berufungsinstanz von den Parteien nicht beliebig neu vorgetragen werden.
Für Versäumnisurteile gelten besondere Regeln. Versäumnisurteile können erlassen werden, wenn eine Partei nicht zum Termin zur mündlichen Verhandlung erscheint oder aber wenn die beklagte Partei nach Klagezustellung nicht erklärt, dass sie sich gegen die Klage verteidigen möchte. Deshalb ist wichtig: Wenn das Gericht Fristen setzt oder Termine anberaumt, müssen Sie diese befolgen, wenn Sie negative Folgen für sich vermeiden wollen.
Für Beschlüsse des Familiengerichts gelten andere Regelungen. Diese können mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschlüsse werden dann durch das Oberlandesgericht überprüft.
Revision
Mit der Revision können Urteile der Berufungsinstanz (in ganz bestimmten Ausnahmen auch Urteile der ersten Instanz) angefochten werden. Auch die Revision ist zwingend von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt einzulegen. Revisionsgericht ist der Bundesgerichtshof.
Die Revision kann nur eingelegt werden, wenn sie das Berufungsgericht vorher in dem Urteil zugelassen hat. Dies ist der Fall, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.
Wenn die Revision vom Berufungsgericht nicht zugelassen wurde und der Streitwert des Verfahrens 20.000 EUR übersteigt, kann die Nichtzulassung mit der sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde angefochten werden. Gibt das Revisionsgericht der Nichtzulassungsbeschwerde statt, ist die Revision statthaft.
Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung des Rechts beruht, also etwa Gesetze nicht richtig angewendet wurden.
Beratungshilfe
Was ist Beratungshilfe?
Beratungshilfe ist eine Leistung, die gewährt werden kann, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Die Bürger werden nämlich nicht durch das Gericht, sondern durch einen von ihnen selbst zu beauftragenden Rechtsanwalt beraten, der hierfür Kosten verlangt. Die Beratungshilfe unterstützt Menschen, die für die Beratung nicht selbst zahlen können. Unter bestimmten Voraussetzungen können diese Beratungskosten durch den Staat übernommen werden.
Durch die Beratungshilfe werden Menschen mit geringem Einkommen so in die Lage versetzt, eine rechtliche Beratung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt oder eine andere Beratungspersonen (z.B. Steuerberater, Rentenberater) in Anspruch zu nehmen.
Die Beratungshilfe ist im Beratungshilfegesetz genau geregelt.
Wann erhalte ich Beratungshilfe?Ein Anspruch auf Beratungshilfe besteht, wenn:
- Rechte außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens wahrgenommen werden sollen, es also noch keinen Prozess bei Gericht gibt,
- der Rechtsuchende die erforderlichen Mittel nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen selbst nicht aufbringen kann,
- keine anderen Möglichkeiten zur Hilfe zur Verfügung stehen, deren Inanspruchnahme dem Rechtsuchenden zuzumuten sind (z. B. Mieterverein, Rechtsschutzversicherung, Schuldnerberatung, Jugendamt) und
- die Wahrnehmung der Rechte nicht mutwillig ist. Das bedeutet, dass in einer vergleichbaren Situation auch eine wirtschaftlich besser gestellte Person auf eigene Kosten Rechtsrat einholen oder sich vertreten lassen würde.
Beratungshilfe wird nur auf Antrag gewährt.
Für die Antragstellung gibt es folgende Möglichkeiten:
- Entweder reichen Sie beim zuständigen Amtsgericht das entsprechende Antragsformular ein nebst Belegen (zum Antragsformular),
- oder Sie legen das entsprechende Antragsformular nebst Belegen bei dem Berater Ihrer Wahl vor.
Was muss ich beachten, wenn ich Beratungshilfe direkt beim Amtsgericht beantragen möchte?
- Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk Ihr Erstwohnsitz liegt.
- Sie sollten Ihren Antrag vor der Beauftragung eines Rechtsanwalts oder eine Rechtsanwältin oder eines anderen Beraters stellen.
- Ein nachträglicher Antrag ist nur binnen vier Wochen nach der Beratung zulässig.
Folgende Unterlagen müssen Sie mit dem Antrag vollständig und aktuell einreichen:
- Unterlagen, aus denen sich die Angelegenheit, für die Beratungshilfe beantragt wird, so genau wie möglich ergibt (Verträge, Rechnungen, Schriftwechsel etc.),
- Belege über Ihr aktuelles, laufendes Einkommen (Lohnabrechnungen, Renten- oder sonstige Bescheide, Mieteinnahmen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeldbescheid, Wohngeldbescheid),
- Zahlungsbelege/Kontoauszüge zu Ihren laufenden Ausgaben (Miete, Nebenkosten, Heizkosten, Versicherungen, Zahlungsverpflichtungen etc.),
- Unterlagen, aus denen sich der Wert all Ihrer vorhandenen Vermögenswerte ergibt (Kontoauszüge, Sparbuch, Lebensversicherung, Grundstücke etc.),
- Personalausweis oder Reisepass.
Sie können den Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe mündlich innerhalb der Sprechzeiten bei dem zuständigen Amtsgericht stellen oder den Antrag mit den oben genannten Unterlagen schriftlich einreichen.
Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden nach den Vorschriften der Prozesskostenhilfe geprüft. Sämtliche Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie über den Beratungsgegenstand müssen Sie durch Belege nachweisen. Nur belegte Angaben können bei der Prüfung berücksichtigt werden.
Was muss ich beachten, wenn ich den Antrag beim Rechtsanwalt stelle?
Sofern Sie Ihren Antrag bei einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin vorgelegt haben, prüft er oder sie die Voraussetzungen für die Beratungshilfe und kann sofort die Rechtsberatung erbringen. In diesem Fall reicht der Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin nachträglich den Antrag bei dem zuständigen Amtsgericht zur Entscheidung über die Beratungshilfe ein. Hierfür gilt eine Frist von vier Wochen seit Beginn der Beratung.
Wie entscheidet das Gericht über meinen Antrag?
Wenn die Bedingungen für Beratungshilfe erfüllt sind, erteilt das Amtsgericht einen Berechtigungsschein, der der Beratungsperson vorgelegt werden kann. Erfüllen Sie die Voraussetzungen nicht oder haben nicht alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt, weist das Amtsgericht den Antrag auf Beratungshilfe zurück. Gegen diese Entscheidung kann als Rechtsbehelf die Erinnerung eingelegt werden.
Was kostet mich die Beratung?Wenn Ihnen Beratungshilfe bewilligt wird, übernimmt die Landeskasse die für die Beratung anfallende Vergütung der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts bzw. einer anderen Beratungsperson (z.B. Wirtschaftsprüfer, Rentenberater usw. …). Bitte beachten Sie jedoch unbedingt, dass die Beratungsperson pro Angelegenheit derzeit eine Beratungsgebühr von 15,00 EUR (§ 44 RVG) verlangen kann. Wird Beratungshilfe abgelehnt, müssen Sie die Kosten für die Beratung vollständig selbst tragen.